Produkt zum Begriff Geschichtsseiten:
-
 Industrialisierung (Henke-Bockschatz, Gerhard)
Industrialisierung (Henke-Bockschatz, Gerhard)
Industrialisierung , Unter "Industrialisierung" wird der sozialökonomische Entwicklungssprozess verstanden, der Agrargesellschaften in Industriegesellschaften umformte - in Gesellschaften, die von maschineller Produktion, freien Unternehmern und Lohnarbeitern, von Mobilität von Waren und Menschen und von großstädtischen Lebensformen geprägt sind. Ausgehend von England durchliefen die meisten Staaten Europas und Nordamerikas sowie einige wenige andere Länder in der Zeit zwischen der Mitte des 18. Jahrhunderts und dem Beginn des Ersten Weltkriegs den Industrialisierungsprozess. Diese Umwandlung ermöglichte das für uns heute so selbstverständliche Wirtschaftswachstum - die Voraussetzung für Wohlstand, aber auch für soziale Probleme, denen v. a. mit den Instrumenten der sozialen Sicherung begegnet wird. Die Industrialisierung ist klassischer Stoff des Geschichtsunterrichts. In diesem Band sind die grundlegenden Quellen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Umwelt, Alltag und Mentalitäten multiperspektivisch und kontrovers zusammengestellt. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 200302, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Fundus - Quellen für den Geschichtsunterricht##, Autoren: Henke-Bockschatz, Gerhard, Seitenzahl/Blattzahl: 256, Fachschema: Geschichte / Unterrichtsmaterial~Industrialisierung, Fachkategorie: Fachspezifischer Unterricht, Zeitraum: 1500 bis heute, Warengruppe: HC/Didaktik/Methodik/Schulpädagogik/Fachdidaktik, Fachkategorie: Industrialisierung und Industriegeschichte, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Wochenschau Verlag, Verlag: Wochenschau Verlag, Verlag: Wochenschau Verlag, Länge: 211, Breite: 149, Höhe: 15, Gewicht: 324, Produktform: Kartoniert, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0050, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 2328364
Preis: 24.90 € | Versand*: 0 € -
 Revolutionen auf dem Rasen (Wilson, Jonathan)
Revolutionen auf dem Rasen (Wilson, Jonathan)
Revolutionen auf dem Rasen , Warum spielen die Engländer so gern Kick-and-rush? Wer erfand den Totaalvoetbal? Und warum hasst ausgerechnet Pep Guardiola Tiki-Taka? In seiner fesselnden Geschichte der Fußballtaktik durchleuchtet Jonathan Wilson die Entwicklung des Spiels: von den chaotischen Anfängen in England bis zum Hochgeschwindigkeitsspiel von heute. Dabei erinnert er an große Trainer und Spieler, die immer wieder den Fußball revolutionierten und ihm mit Innovationen wie dem "W-M-System", dem "Riegel" und der "Raute" völlig neue Dimensionen eröffneten. In dieser überarbeiteten und erweiterten Neuauflage hat Wilson seine Darstellung nun um die taktischen Entwicklungen der letzten 20 Jahre speziell in Deutschland ergänzt: von Ralf Rangnick über Jürgen Klopp bis Julian Nagelsmann. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Auflage: Erweiterte und überarbeitete Neuauflage, Erscheinungsjahr: 20181031, Produktform: Leinen, Autoren: Wilson, Jonathan, Übersetzung: Montz, Markus, Auflage/Ausgabe: Erweiterte und überarbeitete Neuauflage, Seitenzahl/Blattzahl: 606, Abbildungen: Fotos, Keyword: Eine Geschichte der Fußballtaktik; Fußball; Fußballgeschichte; Fußballsysteme; Fußballtaktik; Inverting the pyramid; Jonathan Wilson; Julian Nagelsmann; Jürgen Klopp; Ralf Rangnick; Revolutionen auf dem Rasen; Taktik; Thomas Tuchel, Fachschema: Fußball, Warengruppe: HC/Ballsport, Fachkategorie: Fußball, Thema: Entdecken, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Die Werkstatt GmbH, Verlag: Die Werkstatt GmbH, Verlag: Die Werkstatt, Länge: 222, Breite: 144, Höhe: 47, Gewicht: 749, Produktform: Gebunden, Genre: Sachbuch/Ratgeber, Genre: Sachbuch/Ratgeber, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0002, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 1865496
Preis: 29.90 € | Versand*: 0 € -
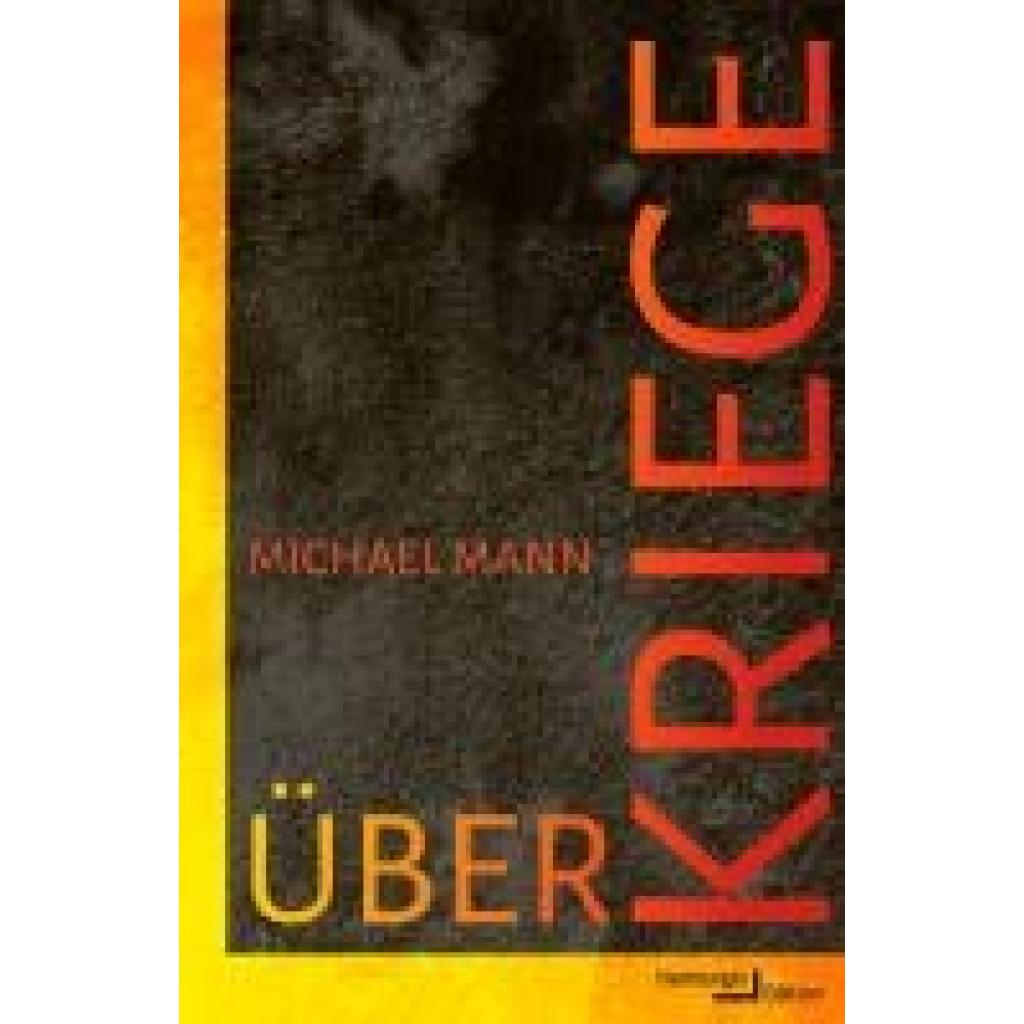 Mann, Michael: Über Kriege
Mann, Michael: Über Kriege
Über Kriege , Warum werden Kriege geführt? Was ist ausschlaggebend für die Entscheidung zum Krieg? Michael Mann erzählt die Geschichte des Krieges vom antiken Rom bis zum Überfall auf die Ukraine, vom kaiserlichen China bis zu Auseinandersetzungen im Nahen Osten, von Japan und Europa bis zur postkolonialen Geschichte Lateinamerikas und zu den Kriegen der Vereinigten Staaten. Obwohl sich die Waffen und die Organisation des Krieges im Laufe der Zeit enorm gewandelt haben, hat sich der Charakter der Entscheidungsprozesse kaum verändert. Fast immer wurde und wird der finale Entschluss von sehr kleinen Gruppen von Machthabern getroffen, manchmal nur von einer Person. Charaktere, Emotionen und Ideologien sind ausschlaggebend. Doch auch Status, Ehre und Ruhm spielen nach wie vor eine große Rolle. Die meisten Herrscher, die Kriege beginnen, verlieren sie, und in historischer Perspektive ist die große Mehrheit der Staaten aufgrund von Kriegen untergegangen. Durch die meisterhafte Verbindung ideologischer, wirtschaftlicher, politischer und militärischer Analysen eröffnet der preisgekrönte Soziologe Michael Mann neue Perspektiven auf die Geschichte und Gegenwart von Kriegen. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 45.00 € | Versand*: 0 € -
 Illegale Kriege (Ganser, Daniele)
Illegale Kriege (Ganser, Daniele)
Illegale Kriege , »Wir, die Völker der Vereinten Nationen - fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat -, haben beschlossen: Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.« Charta der Vereinten Nationen,abgeschlossen in San Francisco am 26. Juni 1945. Mit der Gründung der UNO gilt ein weltweites Kriegsverbot. Nur in zwei Ausnahmen sind kriegerische Maßnahmen zugelassen (Selbstverteidigung oder Mandat des UNO-Sicherheitsrats). Die Realität ist jedoch eine ganz andere. Dieses Buch beschreibt, wie in Vergangenheit und Gegenwart illegale Kriege geführt werden. Es zeigt, wie die Regeln der UNO und vor allem das Kriegsverbot gezielt sabotiert wurden und welch unrühmliche Rolle hierbei die Länder der NATO spielen. Es ist ein Buch von beklemmender Aktualität. , Nachschlagewerke & Lexika > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20230123, Produktform: Kartoniert, Autoren: Ganser, Daniele, Seitenzahl/Blattzahl: 374, Keyword: Internatinaler Strafgerichtshof Den Haag Haager Tribunal Römische Statut 1998 Gründung Putin Baerbock Sondertribunal Funktion Kritk Tribunal Buch, Fachschema: International (Politik)~Rüstung - Abrüstung~Agent~Geheimdienst~Geheimdienst / Spionage~Spion~Spionage - Spionageabwehr~Geopolitik~Deutsche Geschichte / 20. Jahrhundert~Spezialeinheiten~Militär~Militärgeschichte, Fachkategorie: Abrüstung und Rüstungskontrolle~Spionage und Geheimdienste~Geopolitik~Bodentruppen und Kriegsführung~Guerilla und Kriegsführung~Spezialeinheiten und Elitetruppen~Militär: Nachrichtendienst~Moderne Kriegsführung, Region: Deutschland, Zeitraum: ca. 1945 bis ca. 1990 (die Zeit des Kalten Krieges), Fachkategorie: Militärgeschichte: Nachkriegs-Konflikte, Thema: Auseinandersetzen, Text Sprache: ger, Verlag: Westend, Verlag: Westend, Länge: 221, Breite: 154, Höhe: 34, Gewicht: 624, Produktform: Klappenbroschur, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Vorgänger: 2828121, Vorgänger EAN: 9783946778288, eBook EAN: 9783987910142, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0120, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Lagerartikel, Unterkatalog: Taschenbuch, WolkenId: 2700448
Preis: 25.00 € | Versand*: 0 €
-
Was sind gute und vertrauliche Geschichtsseiten?
Es gibt viele gute und vertrauenswürdige Geschichtsseiten im Internet. Einige bekannte Beispiele sind die Seite des Deutschen Historischen Museums, des Bundesarchivs und des Instit...
-
Wie lautet das Thema der Seminararbeit über Kriege im Mittelalter und der Antike?
Das Thema der Seminararbeit lautet "Kriege im Mittelalter und der Antike". Es wird untersucht, wie sich Kriegsführung, Strategien und Taktiken in diesen beiden historischen Epochen...
-
Was unterscheidet das Mittelalter von der Antike?
Was unterscheidet das Mittelalter von der Antike? Im Mittelalter gab es eine starke Dominanz der Kirche und des Christentums, während in der Antike die Religionen vielfältiger ware...
-
Welche Mittelalter- und Antike-Serien könnt ihr empfehlen?
Ich kann dir die Serie "Game of Thrones" empfehlen, die im fiktiven Mittelalter-Königreich Westeros spielt und politische Intrigen, Kriege und fantastische Elemente enthält. Eine w...
Ähnliche Suchbegriffe für Geschichtsseiten:
-
 Verteidigung des deutschen Kolonialismus (Gilley, Bruce)
Verteidigung des deutschen Kolonialismus (Gilley, Bruce)
Verteidigung des deutschen Kolonialismus , Muss die deutsche Kolonialgeschichte neu geschrieben werden? Mit dem vorliegenden Band stellt der US-amerikanische Politologe Bruce Gilley unser sicher geglaubtes Wissen über die koloniale Vergangenheit des Deutschen Reiches auf den Kopf. Faktenbasiert, schonungslos und stets humorvoll entlarvt Gilley die post-moderne Kolonialforschung als Geisel politischer Korrektheit. Nicht die historischen Tatsachen, sondern die Bedürfnisse des politischen Zeitgeistes bestimmen heute in Berlin über die Wahrnehmung dieser historischen Epoche, so Gilley. Entstanden ist dadurch eine semi-religiöse, schuldbeladene Weltsicht, in der weiße Europäer immer Täter, Afrikaner aber stets die Opfer zu sein haben. Eine folgenreiche Fehldeutung, die in diesem Werk gründlichen Widerspruch erfährt. Im Gegenteil war die Kolonialzeit "für die Kolonisierten objektiv gewinnbringend" und für die Kolonisatoren "subjektiv gerechtfertigt", wie Gilley unter Verweis auf prominente Quellen beweist. Eine Sicht auf die Vergangenheit vorzulegen, in der die Deutschen nicht ausnahmslos bösartig, ihre kolonialen Errungenschaften nicht allein von Gräueltaten und Rassismus geprägt waren, braucht Mut - heute mehr denn je. Gilley hat der historischen Forschung mit diesem Grundlagenwerk eine Schneise geschlagen. Es bleibt zu hoffen, dass seine Thesen und Argumente zu lebhaften Debatten anregen und perspektivisch eine Kehrtwende in der erinnerungspolitischen Kultur Deutschlands initiieren können. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Erscheinungsjahr: 202105, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Edition Sonderwege##, Autoren: Gilley, Bruce, Übersetzung: Abelson, Richard, Seitenzahl/Blattzahl: 198, Keyword: Forschung; Geschichtsschreibung; Geschichtsverfälschung; Hetero; Fortschritt; Politische Korrektheit; Hilfe; Kaiserreich; Afrika; Politik; Eingeborene; Verantwortung; Amnesty International; Lobbyismus; Nationalsozialismus, Fachschema: Anthropologie / Kulturanthropologie~Kulturanthropologie~Afrika / Geschichte, Politik, Recht~Imperialismus~Kolonialgeschichte~Kolonialismus~Befreiung~Sklaverei, Fachkategorie: Gesellschaft und Kultur, allgemein~Afrikanische Geschichte: vorkolonial~Kolonialismus und Imperialismus~Nationale Befreiung und Unabhängigkeit, Postkolonialismus~Sklaverei und Abschaffung der Sklaverei~Invasion und Okkupation, Thema: Auseinandersetzen, Warengruppe: HC/Geschichte/20. Jahrhundert, Fachkategorie: Sozial- und Kulturanthropologie, Ethnographie, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Manuscriptum, Verlag: Manuscriptum, Verlag: Manuscriptum Verlagsbuchhandlung Thomas Hoof e.K., Länge: 205, Breite: 131, Höhe: 20, Gewicht: 275, Produktform: Klappenbroschur, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0250, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 25.00 € | Versand*: 0 € -
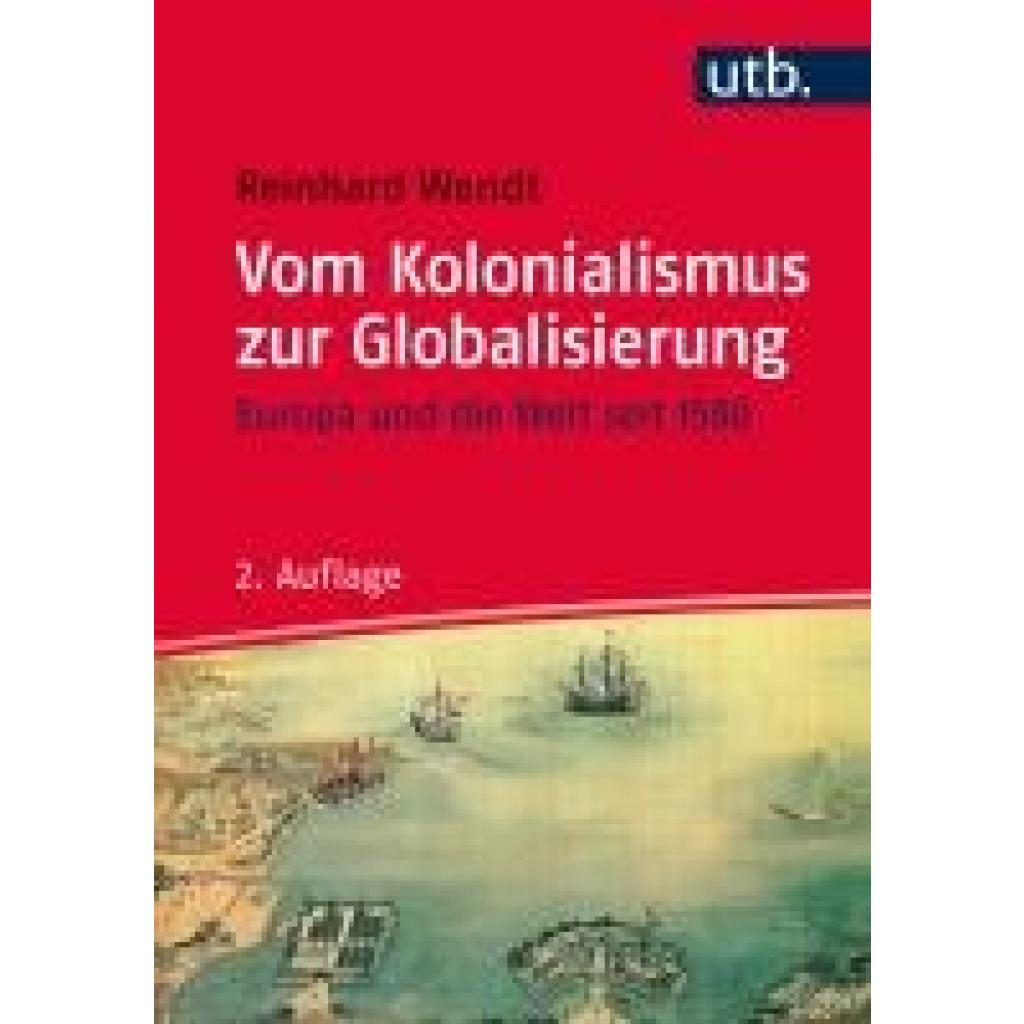 Vom Kolonialismus zur Globalisierung (Wendt, Reinhard)
Vom Kolonialismus zur Globalisierung (Wendt, Reinhard)
Vom Kolonialismus zur Globalisierung , Reinhard Wendt bietet seinen Lesern keine der üblichen historischen Darstellungen europäischer Kolonialherrschaft. Vielmehr erzählt er die Geschichte der Interaktionen, der Kontakte und Austauschprozesse zwischen Europa und der Welt seit 1500. Europa trug dazu bei, das Gesicht der Welt politisch, ökonomisch und kulturell zu verändern. Gleichzeitig aber verwandelte es sich seinerseits durch die Vielfalt der Impulse, die es aus der überseeischen Welt empfing. Seine Geschichte wird hier in ihrer Abhängigkeit von materiellen und immateriellen Importen aus der Fremde geschildert. Zahlreiche Karten, Abbildungen und Fallbeispiele veranschaulichen diese spannend geschriebene "europäische Weltgeschichte". Die zweite Auflage wurde ergänzt und aktualisiert; auch neueste Entwicklungen sind berücksichtigt. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Auflage: 2., aktualisierte Auflage, Erscheinungsjahr: 20151209, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Uni-Taschenbücher#2889#, Autoren: Wendt, Reinhard, Auflage: 16002, Auflage/Ausgabe: 2., aktualisierte Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 455, Abbildungen: 87 schwarz-weiße Abbildungen, Keyword: Austauschprozesse; Europa; Europäische Geschichte; Globalisierung; Imperialismus; Interaktionen; Kolonialherrschaft; Kolonialismus; Kultureller Wandel, Fachschema: Globalisierung~Kolonialgeschichte~Kolonialismus~Europa~Cultural Studies~Kulturwissenschaften~Wissenschaft / Kulturwissenschaften~Europa / Geschichte, Kulturgeschichte~Imperialismus, Fachkategorie: Globalisierung~Politik und Staat~Geschichte allgemein und Weltgeschichte~Europäische Geschichte~Kolonialismus und Imperialismus, Region: Europa, Zeitraum: 1500 bis heute, Bildungszweck: für die Hochschule, Warengruppe: HC/Geschichte/Allgemeines/Lexika, Fachkategorie: Kulturwissenschaften, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: UTB GmbH, Verlag: UTB GmbH, Verlag: UTB, Länge: 216, Breite: 152, Höhe: 30, Gewicht: 684, Produktform: Kartoniert, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Vorgänger EAN: 9783825228897 9783506717214, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: 0, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 26.00 € | Versand*: 0 € -
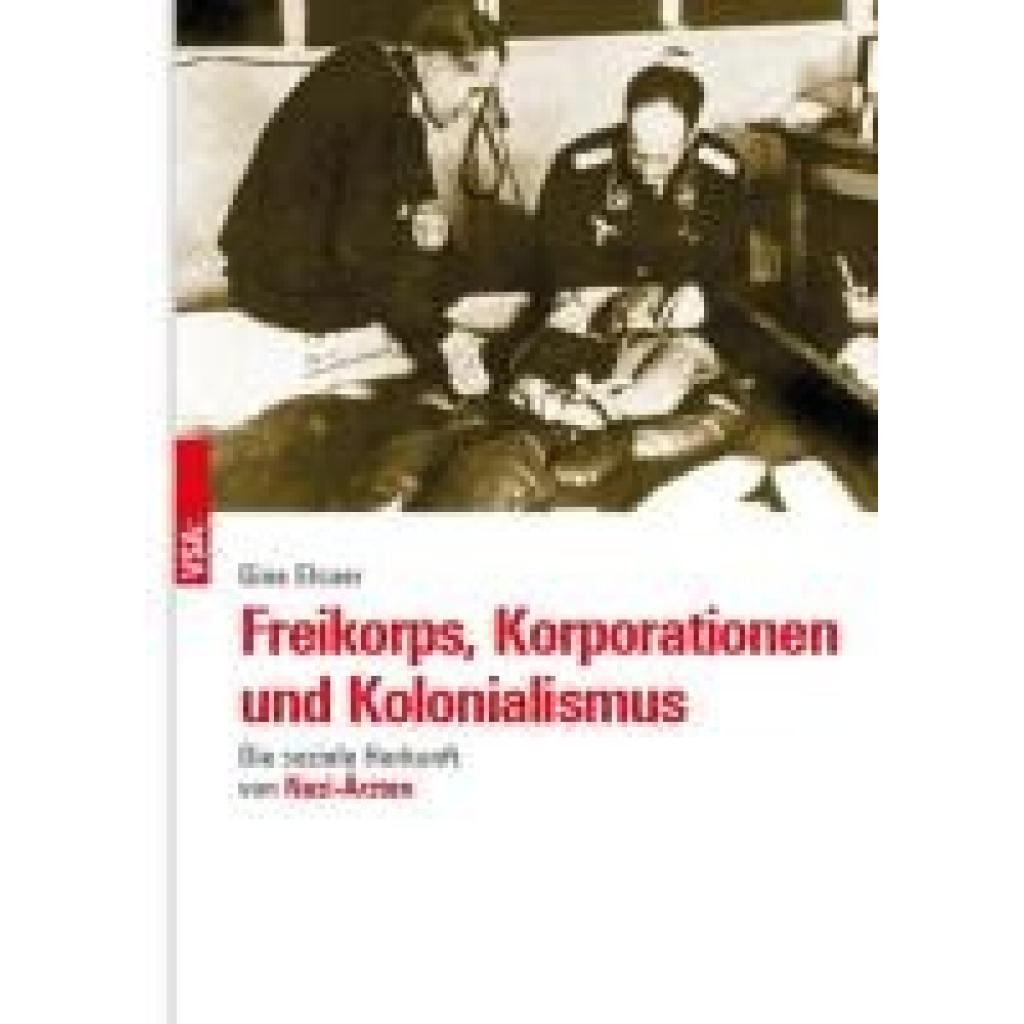 Elsner, Gine: Freikorps, Korporationen und Kolonialismus
Elsner, Gine: Freikorps, Korporationen und Kolonialismus
Freikorps, Korporationen und Kolonialismus , In diesem Buch geht die Autorin unter anderem der Frage nach, ob es eine Kontinuität von der medizinischen Praxis der Kolonialärzte zu den Nazi-Ärzten gab. Unter den sogenannten Schutztruppen waren Ärzte, die die Brutalität jener unterstützten. Deutsche Forscher experimentierten in den Kolonien. Einige ältere Nazi-Ärzte hatten eine koloniale Vergangenheit. Andere Ärzte kämpften in der Weimarer Zeit häufig in Freikorps, waren Mitglieder in Veteranenverbänden und studentischen Korporationen. Sie traten häufig schon vor Beginn der NS-Zeit in die NSDAP oder in die SA oder SS ein. Wie konnten dann von 1933 bis 1945 aus Ärzten Mörder werden, die sich in der Regel an der Euthanasie zur verbrecherischen Tötung von Kranken und Behinderten ohne gesetzliche Grundlage beteiligten? Gab es besondere biografische Merkmale der familiären Herkunft oder der Sozialisation? Gab es Unterschiede in der schulischen oder universitären Ausbildung zwischen Euthanasie-Ärzten und SS-Ärzten in den KZ einerseits und den wenigen Ärzten, die dem Nationalsozialismus widerstanden, andererseits? Denn nicht alle unterwarfen sich der Nazi-Ideologie, es gab neben zu vielen Tätern nur wenige Widerständler unter den Ärzten. Die Untersuchung zu mehr als 100 Euthanasie-Ärzten und mehr als 100 KZ-Ärzten zeigt deren biografische Herkunft auf. Verglichen wird sie mit der von ärztlichen NS-Widerständlern. Alle Ärzte kamen aus der gesellschaftlichen Oberschicht. Wodurch wurden die einen Widerständler und die anderen NS-Täter? Welche biografischen Merkmale unterschieden sie? , Bücher > Bücher & Zeitschriften
Preis: 26.80 € | Versand*: 0 € -
 Von Mäusen, Menschen und Revolutionen (Krause, Monika)
Von Mäusen, Menschen und Revolutionen (Krause, Monika)
Von Mäusen, Menschen und Revolutionen , Was haben Mäuse, Chicago und die Französische Revolution gemeinsam? Sie nehmen in der Biologie beziehungsweise der Sozialforschung jeweils die Rolle von Modellfällen ein. Es handelt sich um besonders beforschte Einzelphänomene, deren Eigenschaften generalisiert werden und unser Verständnis gesellschaftlicher Vorgänge unverhältnismäßig stark prägen. Auch wenn die Untersuchungsgegenstände und Erkenntnisinteressen in den Geistes- und Sozialwissenschaften schwerer zu umreißen sind als in anderen Bereichen, stürzen sich die Forschenden, wie Monika Krause in ihrer viel gelobten Studie zeigt, auf einen Kanon von Objekten: Die Französische Revolution etwa hat allgemeine Vorstellungen des Umsturzes, der Staatsbürgerschaft und der politischen Moderne tiefgreifend beeinflusst, ebenso wie Studien über Ärzt:innen die Agenda für die Forschung über Berufe bestimmt haben. Krause analysiert, wie und warum sich Forschende oft auf immer die gleichen Modellfälle verlassen und wie dieses Vorgehen einer problematischen Selbstbeschränkung gleichkommt, wenn diese Entscheidungen unreflektiert bleiben. Ihr Buch ist ein Wegweiser, um sich Potenziale und Begrenzungen einer Sozialforschung begreiflich zu machen, die selbst maßgeblichen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben hat. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 202306, Produktform: Leinen, Titel der Reihe: Hamburger Edition##, Autoren: Krause, Monika, Übersetzung: Gebauer, Stephan, Seitenzahl/Blattzahl: 264, Keyword: Einzelfälle; Fallstudie; Generalisierung; Kanon; Methode; Methodologie; Sozialwissenschaften; wissenschaftliche Praxis; Wissenschaftsforschung, Fachschema: Soziologie / Theorie, Philosophie, Anthropologie~Forschung (wirtschafts-, sozialwissenschaftlich) / Sozialforschung~Sozialforschung~Empirische Sozialforschung~Sozialforschung / Empirische Sozialforschung, Fachkategorie: Sozialforschung und -statistik, Warengruppe: HC/Sozialwissenschaften allgemein, Fachkategorie: Sozialtheorie, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Originalsprache: eng, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Hamburger Edition, Verlag: Hamburger Edition, Verlag: Hamburger Edition, HIS Verlagsges. mbH, Länge: 216, Breite: 142, Höhe: 18, Gewicht: 394, Produktform: Gebunden, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, eBook EAN: 9783868544862 9783868544879, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0002, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 35.00 € | Versand*: 0 €
-
Warum ist Europa nach der Antike ins Mittelalter zurückgefallen?
Europa fiel nach der Antike ins Mittelalter zurück, weil das weströmische Reich zerfiel und die politische und wirtschaftliche Stabilität verloren ging. Es gab auch eine Reihe von ...
-
Waren Lederrüstungen in der Antike und im Mittelalter üblich?
Ja, Lederrüstungen waren sowohl in der Antike als auch im Mittelalter üblich. Sie wurden von Soldaten und Kriegern als Schutz vor Waffenangriffen getragen. Lederrüstungen waren lei...
-
Wie sah die Werbung früher aus? Steinzeit, Antike, Mittelalter?
In der Steinzeit gab es keine Werbung im heutigen Sinne, da die Menschen in kleinen Gemeinschaften lebten und keine Möglichkeit hatten, Produkte oder Dienstleistungen über größere ...
-
Was sind die Unterschiede zwischen der Antike und dem Mittelalter?
Die Antike war geprägt von der Hochkultur der Griechen und Römer, während das Mittelalter von der Herrschaft der Feudalherren und der christlichen Kirche dominiert wurde. In der An...
* Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und ggf. zuzüglich Versandkosten. Die Angebotsinformationen basieren auf den Angaben des jeweiligen Shops und werden über automatisierte Prozesse aktualisiert. Eine Aktualisierung in Echtzeit findet nicht statt, so dass es im Einzelfall zu Abweichungen kommen kann.